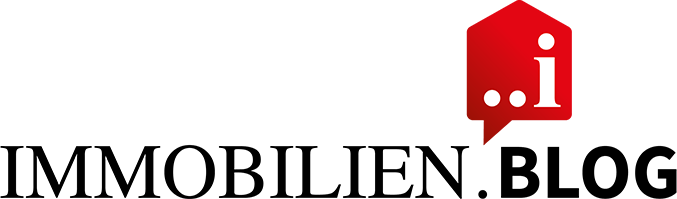In der Praxis kommt es immer wieder vor: Eltern möchten für ihr minderjähriges Kind eine Wohnung oder ein Haus anschaffen – oft mit dem Gedanken, schon früh etwas „auf das sichere Fundament“ zu stellen. Was zunächst ganz einfach klingt, entpuppt sich jedoch schnell als rechtlich verzwickte Angelegenheit. Denn sobald ein Kind Eigentümer einer Immobilie werden soll, greifen besondere Schutzmechanismen – und das Pflegschaftsgericht ist automatisch mit im Boot.
Zustimmung & Genehmigung: Das “doppelte Muss”
Auch wenn das Geschäft im besten Interesse des Kindes liegt, braucht es immer einen Vertrag – und zwar einen, der den besonderen rechtlichen Anforderungen in solchen Fällen entspricht.
Da es sich um eine Vermögensangelegenheit außerhalb des ordentlichen Wirtschaftsbetriebs gemäß § 167 Abs 3 ABGB handelt, kann das minderjährige Kind, das als Erwerber auftritt, den Vertrag – soweit es altersmäßig überhaupt in der Lage ist – nicht eigenständig abschließen. Erforderlich ist daher die Zustimmung beider obsorgeberechtigter Elternteile sowie zusätzlich die Genehmigung des Pflegschaftsgerichts.
In der Praxis bedeutet das: Der Kaufvertrag wird in solchen Fällen regelmäßig unter der aufschiebenden Bedingung der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung abgeschlossen. Erst wenn diese Genehmigung vorliegt, wird der Vertrag rechtswirksam – und erst dann kann das Kind tatsächlich als Eigentümer im Grundbuch eingetragen werden.
Das mag auf den ersten Blick umständlich wirken, ist jedoch gesetzlich zwingend vorgesehen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Kind durch den Erwerb weder rechtlich noch wirtschaftlich benachteiligt oder überfordert wird.

Die Praxis des Genehmigungsverfahrens
In vielen Fällen lädt das Pflegschaftsgericht die Eltern zu einem Gespräch vor. Das klingt formell, ist aber meist ein sachliches, aufklärendes Treffen.
Das Gericht will verstehen, warum der Kauf erfolgen soll, wer die Kosten trägt, und ob das Ganze wirklich im Sinne des Kindes ist. Nur wenn all diese Punkte überzeugend dargelegt sind, wird die Genehmigung erteilt.
Ziel ist dabei nie, den Eltern Steine in den Weg zu legen – sondern sicherzustellen, dass das Kind am Ende tatsächlich einen Vorteil aus der Transaktion hat.
Worauf das Gericht besonders achtet
Keine Belastungen auf der Liegenschaft
Ein besonders sensibler Punkt ist die Frage, ob auf der Liegenschaft irgendwelche Belastungen (z.B. Hypotheken) bestehen. Hier ist das Gericht äußerst streng. In der Praxis zeigt sich immer wieder: Selbst ein lebenslanges Wohnrecht zugunsten der Eltern wird häufig nicht akzeptiert.
Der Grund ist einfach: Das Kind soll „frei von Lasten“ Eigentümer werden. Die Vorstellung dahinter ist, dass das Kind irgendwann unabhängig und unbelastet in die Selbstständigkeit starten kann – und nicht von vornherein mit rechtlichen Bindungen belegt ist, die seinen Handlungsspielraum einschränken.
Keine Kosten für das Kind
Ebenso wichtig ist, dass das Kind mit keinerlei Kosten belastet wird. Das umfasst sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Kauf und der Eintragung des Eigentums entstehen.
Konkret bedeutet das:
- Die Grunderwerbsteuer,
- die Eintragungsgebühr,
- die Kosten für die Vertragserrichtung,
- und sämtliche Nebenkosten
müssen von den Eltern getragen werden.
Das sollte ausdrücklich im Vertrag festgehalten sein, damit kein Zweifel besteht.
Darüber hinaus verlangen viele Gerichte eine separate Verpflichtungserklärung, in der sich die Eltern verbindlich verpflichten, auch die laufenden Kosten – also Betriebskosten oder etwaige Instandhaltungsarbeiten – bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes zu übernehmen.
Diese Praxis mag streng erscheinen, hat aber ihren Sinn: Das Kind soll Eigentümer, aber nicht Kostenträger sein.
Zeit – der oft unterschätzte Faktor
In der täglichen Praxis zeigt sich immer wieder: Rechtzeitige Planung ist das A und O. Pflegschaftsgerichtliche Genehmigungen benötigen ihre Zeit – in der Regel einige Wochen, in Einzelfällen aber auch mehrere Monate. Diese Verfahrensdauer sollte bei der Gestaltung und Abwicklung von Liegenschaftstransaktionen unbedingt berücksichtigt werden.
Gerade im Immobilienbereich, wo oft feste Übergabetermine oder Finanzierungsläufe im Hintergrund stehen, kann Zeit ein entscheidender Faktor sein. Umso wichtiger ist es, nicht nur selbst frühzeitig zu planen, sondern auch den Verkäufer rechtzeitig einzubinden und zu informieren. Verkäufer möchten naturgemäß ihr Geld so bald wie möglich erhalten. Sie sollten daher von Beginn an wissen, dass die endgültige Wirksamkeit des Kaufvertrags erst mit der Genehmigung durch das Pflegschaftsgericht eintritt – und dass dieses Verfahren, selbst bei reibungslosem Ablauf, einige Zeit in Anspruch nimmt.
Ein weiterer Aspekt, der häufig übersehen wird: Die pflegschaftsgerichtliche Genehmigung wird auf der Originalurkunde des Kaufvertrags erteilt. Diese verbleibt bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist beim Gericht und wird erst danach (zB an die Kanzlei) zurückübermittelt. Zwar besteht die Möglichkeit, einen Rechtsmittelverzicht zu erklären, wodurch die Entscheidung grundsätzlich rascher rechtskräftig wird – in der Praxis erfolgt die Rückübermittlung der Originalurkunde jedoch häufig trotzdem nicht unmittelbar. Auch das sollte bei der Zeitplanung berücksichtigt werden.

Das Treuhandkonto – kleine Formalität, große Wirkung
Nicht zu unterschätzen ist auch die Eröffnung des Treuhandkontos. Tritt ein minderjähriges Kind als Käufer auf, muss es bei der Kontoeröffnung ausdrücklich als Erwerber angegeben werden – vertreten durch die obsorgeberechtigten Elternteile. In der Praxis führt das immer wieder zu Verzögerungen: Einige Banken verlangen bereits vor der Kontoeröffnung die pflegschaftsgerichtliche Genehmigung, was für die Abwicklung der Transaktion äußerst unpraktisch ist.
Der Grund liegt auf der Hand: Die pflegschaftsgerichtliche Genehmigung wird naturgemäß erst nach Abschluss des Kaufvertrags erteilt. Wird ihre Vorlage bereits vor Eröffnung des Treuhandkontos verlangt, kann das den gesamten Ablauf blockieren. Gerade weil es im Interesse aller Beteiligten liegt, sämtliche Transaktionsdokumente – insbesondere die Treuhandmeldung – gleichzeitig zu unterzeichnen, führt eine solche Vorgehensweise oft zu Unsicherheit und Verzögerung – etwa dann, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Bank die Eröffnung des Treuhandkontos trotz vorliegender Genehmigung nicht gestattet.
TIPP: Es empfiehlt sich, bereits im Vorfeld abzuklären, welche Bank bereit ist, ein Treuhandkonto auch vor dem Vorliegen der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung zu eröffnen. Eine frühzeitige Abstimmung mit der abwickelnden Bank schafft hier Klarheit und sorgt dafür, dass die Transaktion ohne vermeidbare zeitliche Hürden abgewickelt werden kann.
Offenheit und Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg
In der täglichen Anwendung hat sich gezeigt, dass Transparenz und Kommunikation bei Liegenschaftstransaktionen mit Minderjährigen besonders wichtig sind. Ein offenes Gespräch zwischen den Parteien und dem Gericht – idealerweise bereits vor der Vertragsunterzeichnung – verhindert Missverständnisse und sorgt für eine realistische Erwartungshaltung auf allen Seiten. Wird der Zeitplan offen besprochen und das Verfahren beim Pflegschaftsgericht nachvollziehbar erklärt, entsteht meist auch auf Verkäuferseite Verständnis für die notwendigen Schritte.
Wenn diese Offenheit von Beginn an gelebt wird, verläuft auch die weitere Abwicklung meist reibungslos. Mit etwas Geduld, klarer Abstimmung und guter Vorbereitung lässt sich der Ablauf wesentlich erleichtern.
Vielen Dank für diesen sehr wertvollen Beitrag an:
RA Mag. Anna Selina Picha LL.M.
Rotenturmstraße 5-9, 1010 Vienna
+43 1 928 163 40 04