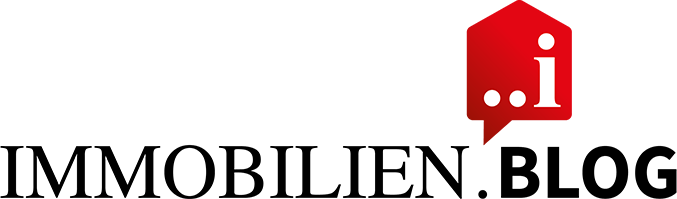In Zeiten steigender Immobilienpreise ist Wohneigentum ein echter Glücksfall – innerhalb der Ehe jedenfalls so lange, wie die Beziehung oder Ehe stabil bleibt. Doch was passiert mit dem gemeinsamen Haus oder der gemeinsamen Wohnung, wenn sich Ehepaare trennen oder scheiden lassen? Dieser Beitrag beleuchtet aus rechtlicher Sicht nach deutschem Recht, welche Möglichkeiten es im Falle einer Trennung oder Scheidung gibt, wie mit dem gemeinsamen Eigentum umgegangen werden kann und worauf betroffene Paare besonders achten sollten.

Wer darf in der Immobilie wohnen bleiben?
Zunächst einmal gilt: Haben beide Ehepartner gemeinsam eine Immobilie gekauft, haben auch beide das gleiche Recht, dort zu wohnen – unabhängig davon, wer gerade dort lebt oder wer die Immobilie bezahlt hat.
Im Idealfall einigen sich die Ehepartner einvernehmlich, wer in der Immobilie verbleibt. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, ob einer der Partner künftig für gemeinsame Kinder sorgt. Denn im Sinne des Kindeswohls wird häufig dem betreuenden Elternteil das Wohnrecht eingeräumt, um den Kindern einen zusätzlichen Umzug zu ersparen.
Wichtig zu wissen:
- Derjenige, der auszieht, verliert nicht automatisch Rechte am Eigentum.
- Wer allein in der Immobilie bleibt, muss in der Regel auch die laufenden Kosten (z. B. Nebenkosten) tragen.
- Zudem steht dem ausgezogenen Ehepartner oft eine sogenannte Nutzungsentschädigung zu, also ein finanzieller Ausgleich dafür, dass der andere die Immobilie allein nutzt.
Die Höhe dieser Entschädigung orientiert sich an der ortsüblichen Miete.
Was tun bei Streit? Das Wohnungszuweisungsverfahren
Wenn sich die Ehepartner nicht einigen können, wer in der Immobilie bleiben soll, kann einer von ihnen beim Familiengericht ein sogenanntes Wohnungszuweisungsverfahren beantragen. Das Gericht entscheidet dann, wer in der Immobilie wohnen darf. Gerichtliche Entscheidungen in Wohnungszuweisungsverfahren sind meist erstmal nur vorübergehend und gelten entweder für eine Dauer von 6 Monaten oder bis zur rechtskräftigen Scheidung.
Allerdings greift das Gericht nur in Ausnahmefällen ein, zum Beispiel bei Härtefällen, etwa bei häuslicher Gewalt, Drogenmissbrauch oder vergleichbaren Umständen. In allen anderen Fällen wird versucht, die Parteien zu einer gütlichen Einigung zu bewegen, ggf. mit Hilfe einer Mediation.
Wem gehört was? Die Eigentumsverhältnisse
Ein zentraler Punkt bei Trennung oder Scheidung ist die Frage nach dem Eigentum an der Immobilie. Häufig sind beide Ehepartner je zur Hälfte als Eigentümer im Grundbuch eingetragen, manchmal auch in einem anderen Verhältnis, je nach individueller Vereinbarung.
Wichtig zu wissen:
- Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kann nur gemeinsam beschlossen und notariell beurkundet werden.
- Der Ehepartner, der in der Immobilie bleiben will, muss den anderen Partner in der Regel auszahlen, um Alleineigentümer zu werden.
Dafür ist eine Wertermittlung der Immobilie notwendig. Diese sollte idealerweise durch einen neutralen und ortskundigen Immobilienexperten erfolgen. Das ist vor allem bei dynamischen Immobilienmärkten entscheidend, in denen die Immobilienpreise stetig variieren.

Verkauf oder Vermietung als gemeinsame Lösung
Wenn sich keiner der Ehepartner die Immobilie allein leisten kann oder will, ist der gemeinsame Verkauf eine häufig gewählte Alternative. Der Erlös wird dann in der Regel hälftig aufgeteilt, sofern keine anderen vertraglichen Vereinbarungen bestehen.
Eine weitere Möglichkeit ist die gemeinsame Vermietung: Beide Ehepartner bleiben Eigentümer und vermieten das Objekt zusammen. Die Mieteinnahmen können z. B. zur Tilgung eines laufenden Kredits verwendet oder zwischen den Partnern aufgeteilt werden. Diese Lösung erfordert allerdings ein gewisses Maß an Kooperation und Kommunikation, was nach einer Trennung nicht immer gegeben ist.
Zwangsversteigerung als letzter Ausweg
Wenn keine Einigung möglich ist, bleibt als letzter Schritt die sogenannte Teilungsversteigerung. Dabei wird die Immobilie durch das örtliche Amtsgericht öffentlich versteigert.
Die Teilungsversteigerung kann einseitig von einem Ehepartner beim zuständigen Amtsgericht beantragt werden, auch gegen den Willen des anderen. Für beide Seiten ist das meist die ungünstigste Lösung, sowohl emotional als auch finanziell. Denn neben dem oft belastenden Verfahren ist zu beachten, dass der Preis, der bei einer solchen Zwangsversteigerung erzielt werden kann, meist weit unter dem auf dem freien Markt erzielbaren Preis liegt.

Was passiert mit dem laufenden Kredit?
In den meisten Fällen ist eine gemeinsame Immobilie durch einen Kredit finanziert, den beide Ehepartner während der Ehe gemeinsam aufgenommen haben. Auch nach der Trennung gilt:
Beide Ehepartner haften gegenüber der Bank als Gesamtschuldner – also gemeinsam und vollständig. Das bedeutet: Die Bank kann sich bei Zahlungsausfall an jeden der beiden wenden und zwar unabhängig davon, wer gerade in der Immobilie wohnt oder wer ursprünglich die Kreditraten gezahlt hat.
Daher ist es oft sinnvoll, dass derjenige Ehepartner, der die Immobilie übernimmt, auch den Kredit allein übernimmt. Das ist allerdings nur möglich, wenn die Bank zustimmt. Voraussetzung ist in der Regel, dass der übernehmende Ehepartner die nötige Bonität mitbringt.
Alternative Lösung: Der Kredit läuft weiterhin auf beide Ehepartner, aber es wird intern vereinbart, dass der in der Immobilie verbleibende Partner die Raten allein übernimmt. In diesem Fall kann eine gegenseitige Verrechnung erfolgen: Der in der Immobilie verbleibende Ehepartner zahlt den Kredit allein ab und verzichtet auf seinen Anspruch gegen den anderen, sich am Kredit zu beteiligen. Der andere Ehepartner verzichtet gegenüber dem in der Immobilie verbleibenden Ehepartner im Gegenzug auf seinen Anspruch auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung.
Vorfälligkeitsentschädigung bei Verkauf
Soll die Immobilie verkauft und der Kredit aus dem Verkaufserlös abgelöst werden, verlangen Banken häufig eine Vorfälligkeitsentschädigung. Diese Gebühr entsteht, weil die Bank durch die vorzeitige Rückzahlung des Kredits Zinszahlungen verliert. Diese zusätzlichen Kosten sollten frühzeitig in die Entscheidung einbezogen werden.
Fazit
Trennung oder Scheidung bringen neben emotionalen Belastungen auch komplexe finanzielle und rechtliche Fragen mit sich. Das gilt besonders dann, wenn eine gemeinsame Immobilie im Spiel ist. Ob es darum geht, wer in der Immobilie bleiben darf, wie Eigentum und Kredit geregelt werden oder ob ein Verkauf infrage kommt – eine frühzeitige und einvernehmliche Einigung kann helfen, langwierige und teure Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Dieser Beitrag bezieht sich auf die Rechtslage in Deutschland. In Österreich oder der Schweiz gelten teils abweichende Regelungen. Eine anwaltliche Beratung vor Ort ist daher im Einzelfall empfehlenswert!
Großer Dank an Herrn Rechtsanwalt Niklas Clamann für diesen Gastbeitrag!
Herr Clamann betreibt eine Kanzlei für Familienrecht und führt bundesweit das Verfahren der sogenannten Onlinescheidung durch.